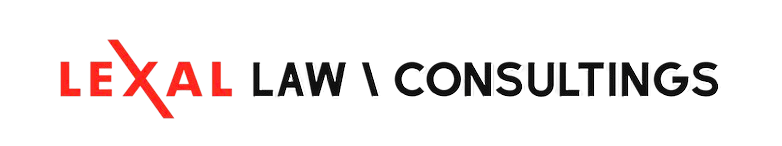Wenn Chatverläufe weitergegeben werden – rechtliche Bewertung von Screenshots und Datenschutzfragen
Immer häufiger werden private Chatverläufe per Screenshot gespeichert oder weitergeleitet – häufig ohne Bewusstsein für die rechtlichen Konsequenzen. Dieser Beitrag erläutert, wann die Erstellung oder Weitergabe solcher Screenshots zulässig ist und wann sie gegen Datenschutz- oder Persönlichkeitsrechte verstößt.
1. Ausgangssituation
In der modernen digitalen Kommunikation werden persönliche, berufliche und vertrauliche Informationen regelmäßig über Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram, Signal oder Instagram ausgetauscht.
Zunehmend kommt es jedoch vor, dass Chatverläufe durch Screenshots festgehalten und anschließend an Dritte weitergeleitet werden.
Was nach einem harmlosen Vorgang klingt, kann schnell zu datenschutzrechtlichen und zivilrechtlichen Verstößen führen.
2. Erstellung von Screenshots für den eigenen Gebrauch
Das reine Erstellen eines Screenshots eines Chats ist grundsätzlich zulässig, solange dies ausschließlich privaten oder familiären Zwecken dient. Die sogenannte Haushaltsausnahme des Art. 2 Abs. 2 lit. c DSGVO schließt derartige Handlungen vom Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung aus.
Solange der Screenshot nicht an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht wird, handelt es sich um keine Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne des Art. 4 Nr. 2 DSGVO.
Beispiel:
Eine Person fertigt einen Screenshot eines Chats an, um eine Terminvereinbarung festzuhalten. Der Screenshot bleibt privat gespeichert.
→ Erlaubt, da keine Weitergabe erfolgt.
3. Weitergabe von Screenshots an Dritte
Sobald ein Screenshot außerhalb des privaten Bereichs verwendet oder geteilt wird, greift die DSGVO vollständig.
Eine Weitergabe ist nur zulässig, wenn eine der Rechtsgrundlagen des Art. 6 Abs. 1 DSGVO vorliegt:
Einwilligung der betroffenen Person (lit. a),
Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung (lit. b),
rechtliche Verpflichtung (lit. c),
oder ein berechtigtes Interesse (lit. f).
Ein berechtigtes Interesse kann z. B. dann bestehen, wenn der Screenshot zur Beweissicherung, zur Rechtsverteidigungoder zur Abwehr von Rechtsansprüchen dient.
Wird ein Screenshot ohne eine dieser Voraussetzungen weitergegeben, liegt eine unzulässige Datenverarbeitung und damit ein Verstoß gegen Art. 6 DSGVO vor.
Betroffene können Löschung, Unterlassung und Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO verlangen.
Beispiel:
A leitet einen privaten Chat mit B an Dritte weiter, um diesen bloßzustellen oder in einem Konflikt Stimmung zu erzeugen.
→ Unzulässig, da kein berechtigtes Interesse vorliegt.
4. Zivilrechtlicher Schutz – allgemeines Persönlichkeitsrecht
Neben der DSGVO schützt auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht gemäß Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG sowie §§ 823, 1004 BGB analog.
Die unbefugte Weitergabe vertraulicher Chatverläufe kann eine rechtswidrige Persönlichkeitsrechtsverletzungdarstellen, insbesondere wenn dadurch die Ehre, das soziale Ansehen oder die Privatsphäre des Betroffenen beeinträchtigt wird.
Rechtsfolgen:
Anspruch auf Unterlassung,
Anspruch auf Löschung,
ggf. Widerruf falscher Behauptungen,
und Schadensersatz oder Geldentschädigung.
5. Strafrechtliche Bewertung (§ 201 StGB, §§ 185 ff. StGB)
Das Strafgesetzbuch schützt die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes (§ 201 StGB). Zwar bezieht sich diese Vorschrift primär auf Tonaufnahmen, doch kann sie in Einzelfällen analog Anwendung finden, wenn vertrauliche schriftliche Kommunikation unbefugt weitergegeben wird.
Darüber hinaus können die Straftatbestände
der Beleidigung (§ 185 StGB),
der üblen Nachrede (§ 186 StGB), oder
der Verleumdung (§ 187 StGB)
erfüllt sein, wenn durch die Weitergabe ehrverletzende oder unwahre Behauptungen verbreitet werden.
Wird dabei ein Profilbild oder anderes persönliches Bildnis unbefugt mitveröffentlicht, kann zusätzlich § 33 KunstUrhG einschlägig sein.
6. Abgrenzung: Berechtigtes Interesse und Ausnahmen
Eine Weitergabe kann ausnahmsweise zulässig sein, wenn sie zur Rechtsverteidigung, zur Dokumentation rechtswidriger Handlungen oder zur Wahrung eines öffentlichen Interesses erforderlich ist.
Hier ist stets eine Interessenabwägung vorzunehmen: Das Offenbarungsinteresse muss das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen überwiegen.
Reine Neugier, Klatsch oder emotionale Motive genügen keinesfalls.
7. Handlungsempfehlungen für Betroffene
Beweise sichern: Screenshot der Weitergabe, Zeitpunkt, Empfänger.
Löschung und Unterlassung verlangen: Schriftliche Aufforderung mit Fristsetzung.
Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht: Art. 77 DSGVO.
Zivilrechtliche Schritte: Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche (§§ 823, 1004 BGB analog, Art. 82 DSGVO).
Strafanzeige: Bei ehrverletzender oder verleumderischer Weitergabe (§§ 185 ff. StGB).