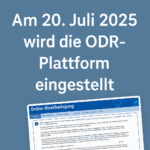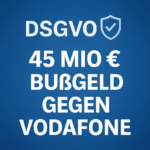Mit dem Urteil VI ZR 1370/20 hat der Bundesgerichtshof (BGH) ein starkes Signal zum Schutz der Privatsphäre gesetzt. Die Entscheidung macht klar: Heimlich erstellte Videoaufnahmen dürfen nicht als Beweismittel verwendet werden, wenn sie gegen die DSGVO verstoßen. Unternehmen, die auf Überwachung setzen, müssen daher genau prüfen, ob ihr Vorgehen rechtlich haltbar ist – sonst drohen nicht nur Beweisverwertungsverbote, sondern auch erhebliche datenschutzrechtliche Konsequenzen.
Der Fall: Illegale Videoüberwachung zur Beweisgewinnung
Im konkreten Fall stritten eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft und eine Mieterin, die zwei Wohnungen bewohnte.
Das Wohnungsunternehmen vermutete, dass die Mieterin die Wohnungen unerlaubt untervermietete. Diese Annahme entstand, nachdem ein Polizeieinsatz wegen Ruhestörung Hinweise auf eine Mehrfachnutzung der Räume gegeben hatte. Um den Verdacht zu untermauern, beauftragte das Unternehmen eine Detektei, die einen Monat lang den Eingangsbereich der Wohnungen mit versteckten Kameras überwachte.
Dabei wurde detailliert protokolliert, wer ein- und ausging – mit dem Ergebnis, dass die Untervermietung bestätigt schien. Die Wohnungsbaugesellschaft forderte daraufhin die Räumung der beiden Wohnungen. Die Mieterin wehrte sich jedoch vor Gericht und argumentierte, dass die gewonnenen Informationen rechtswidrig erlangt worden seien.
Das Urteil des BGH: Beweisverwertungsverbot wegen Datenschutzverstoß
Der BGH entschied zugunsten der Mieterin und stellte fest: Das Unternehmen hat kein Recht auf Räumung, da die Beweise durch grundrechtswidrige Videoüberwachung erlangt wurden.
Warum war die Überwachung illegal?
• Kein öffentlicher Raum: Der überwachte Bereich war nicht öffentlich zugänglich, weshalb eine Videoüberwachung nur unter strengen Voraussetzungen zulässig gewesen wäre.
• Fehlende Rechtsgrundlage: Es lag keine Einwilligung der Betroffenen vor, und es gab keine gesetzliche Erlaubnis für die Überwachung.
• Personenbezogene Daten wurden automatisiert verarbeitet: Die Speicherung und Analyse der Aufnahmen stellt eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten dar, die den Schutzvorgaben der DSGVO unterliegt.
• Mildere Alternativen waren möglich: Der BGH betonte, dass das Unternehmen stattdessen andere Maßnahmen hätte nutzen können – beispielsweise Befragungen von Nachbarn oder Testanfragen zur Scheinanmietung.
Da das Unternehmen sich für die rechtswidrige Überwachung entschieden hatte, waren die gesammelten Beweise unbrauchbar.
Relevanz für Unternehmen: Datenschutz hat Vorrang
Mit dieser Entscheidung unterstreicht der BGH, dass Datenschutzverstöße gravierende Folgen haben können – nicht nur durch mögliche Bußgelder, sondern auch durch den Verlust wichtiger Beweise in gerichtlichen Verfahren. Unternehmen, die Videoüberwachung als Mittel zur Beweissicherung nutzen, müssen daher besonders vorsichtig sein.
Was Unternehmen jetzt beachten müssen
Die Kernaussage des Urteils ist klar: Heimliche Videoaufnahmen sind ein hohes Risiko. Wer sie einsetzt, riskiert nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch, dass seine gesamte Beweisführung zusammenbricht. Deshalb sollten Unternehmen folgende Punkte beachten:
1. Prüfung der Rechtsgrundlage: Jede Form der Videoüberwachung muss rechtlich abgesichert sein. In nicht-öffentlichen Bereichen ist sie fast nie ohne Einwilligung erlaubt.
2. Alternative Maßnahmen bevorzugen: Es gibt oft andere Möglichkeiten, um Informationen zu gewinnen – sei es durch Zeugenaussagen, Testanfragen oder andere Beobachtungsmethoden.
3. Speicherung und Nutzung minimieren: Auch wenn eine Überwachung zulässig ist, sollte die Speicherung auf das absolut Notwendige beschränkt bleiben.
4. Transparenz wahren: Wenn eine Videoüberwachung unvermeidlich ist, sollten Betroffene so früh wie möglich informiert werden.
5. Datenschutzrichtlinien einhalten: Unternehmen sollten klare interne Vorgaben zur Videoüberwachung haben, um Verstöße zu vermeiden.
Fazit: Datenschutzverstöße können Verfahren kippen
Das Urteil des BGH (VI ZR 1370/20) verdeutlicht, dass unrechtmäßig erlangte Beweise vor Gericht nicht verwertbar sind. Unternehmen müssen daher bei der Nutzung von Überwachungsmaßnahmen höchste Sorgfalt walten lassen.
Die Entscheidung setzt ein klares Signal: Der Datenschutz hat Vorrang, und Verstöße können sowohl finanzielle als auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Gerade im sensiblen Bereich des Wohnungs- und Arbeitsrechts sollten Unternehmen daher alternative, datenschutzkonforme Methoden nutzen, um Konflikte zu lösen – denn illegal gesammelte Beweise sind im Zweifel wertlos.